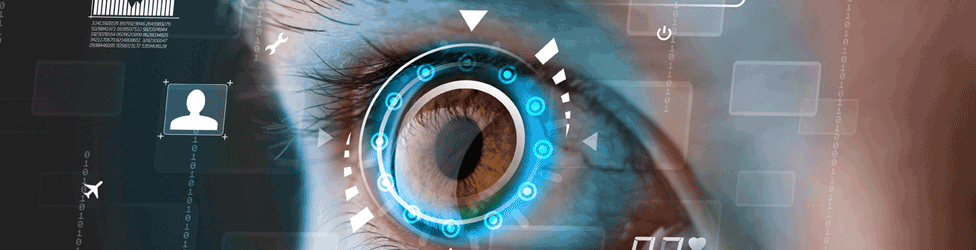
Recensies
Rechtsgeleerdheid
| Recensies: 7 | Pagina 1 van 1 |
|
|
Recensie: 07.12.2009Prof. Dr. Herbert Küpper, Jahrbuch für Ostrecht, Band 50 (2009, S. 543-544) Reeks: Rechtswissenschaft Philipp Schwartz - Das Lettländische Zivilgesetzbuch vom 28. Januar 1937 und seine Entstehungsgeschichte978-3-8322-7758-1 Das lettische Zivilgesetzbuch von 1937 ist nicht nur ein zentrales Monument der neuzeitlichen baltischen Rechtsentwicklung, sondern zugleich auch eine der großen römisch-rechtlichen Kodifikationen des 20. Jahrhunderts. Und es ist ganz nebenbei auch wieder das... » meer |
|---|---|
|
|
Recensie: 01.12.2009Louis Pahlow, Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 31 Jahrgang 2009, Nr. 3/4, S. 319-320 Reeks: Rechtswissenschaft Thomas Mogg - Die Kodifikation von Verlagsrecht und Verlagsvertrag in DeutschlandDie Geschichte des Gesetzes über das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901 und seine Vorgeschichte 978-3-8322-5317-2 Die Geschichte des Verlagsrechts hat bis auf wenige Beiträge, u.a. von Ludwig Gieseke, Martin Vogel oder Elmar Wadle, bislang noch keine ausführliche Bearbeitung erfahren. Als einer der ältesten Vertragstypen über ein Recht des geistigen Eigentums lassen sich... » meer |
|
|
Recensie: 18.11.2009ZPol-Heft 3/07 Reeks: Rechtswissenschaft Richard Albrecht - Völkermord(en)Genozidpolitik im 20. Jahrhundert 978-3-8322-5055-3 Albrecht ist Sozialwissenschaftler, er habilitierte sich im Fach Politikwissenschaft und ist Herausgeber des Online-Magazins "rechtskultur.de" für Menschen- und Bürgerrechte. Der Autor diskutiert die Genozidpolitik im 20. Jahrhunder unter der Leitfrage von Völkermord-... » meer |
|
|
Recensie: 15.10.2009kommunale Literaturdatenbank ORLIS Reeks: Rechtswissenschaft Holger Dann - Alternativen zur Gewerbesteuer978-3-8322-7589-1 Zunächst werden die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Kommunalsteuern dargestellt und die Frage geklärt, wem die Gesetzgebungskompetenz zur Schaffung einer Gewerbesteueralternative zukommt. Es wird untersucht, ob die Gewerbesteuer verfassungsrechtlich garantiert... » meer |
|
|
Recensie: 25.09.2009ETDE - Energy Database-production no.:DE09GA154 Reeks: Berliner Schriftenreihe zum Steuer- und Wirtschaftsrecht Arne Schmidt - Der Pflichtteilsergänzungsanspruch im ErbschaftsteuerrechtVoraussetzungen und Folgen der Steuerbarkeit 978-3-8322-8391-9 This work focuses on the investigation of resonantly driven micromechanical energy harvesters. They are based on electromechanically coupled spring-mass-systems, converting mechanical vibrations into electrical energy by employing appropriate physical transduction... » meer |
|
|
Recensie: 11.09.2009philtrat nummer 91, Juli 2009, S. 10 Reeks: Juristische Lesebücher Dieter Weber - Justitia in der Welt von Musik, Sport und Kunst978-3-8322-7017-9 Darf man seinem Nachbarn verbieten, den ganzen Tag Saxofon zu üben? Und wie gründet man eine eigene Firma? Rechtswissenschaftliche Fragen können in vielen Kontexten auftreten. Der Richter Dieter Weber hat mit Justitia in der Welt von Musik, Sport und Kunst ein... » meer |
|
|
Recensie: 01.08.2009European Business Development Institute Newsletter, August 2009 Reeks: Augsburger Schriften zum Arzneimittel- und Medizinprodukterecht Ulrich M. Gassner (Hrsg.) - Marktüberwachung und Vigilanz im Umbruch3. Augsburger Forum für Medizinprodukterecht 978-3-8322-7468-9 Dieser Tagungsband präsentiert Ergebnisse des 3. Augsburger Forums für Medizinprodukterecht, das im Oktober 2007 stattfand. Zentrale Aspekte der Nachmarktkontrolle von Medizinprodukten werden behandelt. Die Themen reichen von den Grundlagen der Überwachung über... » meer |
|