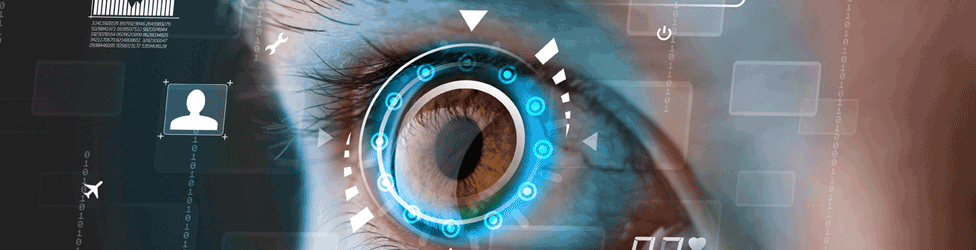
Recensies
Geesteswetenschappen • Filosofie
| Recensies: 2 | Pagina 1 van 1 |
|
Oxana Kosenko Sowjetische Archivpolitik in der SBZ 1945 bis 1949
Nachdem 1991 die Existenz des Zentralen Staatlichen Sonderarchivs in Moskau bekannt wurde, fand die Frage der Rückführung deutscher Bestände starke Beachtung. Oxana Kosenko untersucht in ihrer 2018 erschienenen Dissertation »Sowjetische Archivpolitik in der SBZ 1945 bis 1949« die Praxis und Ziele der Aktenbeschlagnahmungen der sowjetischen Besatzungsmacht in Ostdeutschland. Die Arbeit fragt weiter nach den Entscheidungsprozessen bei den Rückgaben und geht insofern über das Jahr 1949 hinaus. Quelle: Militärgeschichtliche Zeitschrift, 82/1 (2023), S.250-253 |
Recensie: 17.05.2023Militärgeschichtliche Zeitschrift, 82/1 (2023), S.250-253 Reeks: Geschichtswissenschaft Oxana Kosenko - Sowjetische Archivpolitik in der SBZ 1945 bis 1949978-3-8440-6307-3 Nachdem 1991 die Existenz des Zentralen Staatlichen Sonderarchivs in Moskau bekannt wurde, fand die Frage der Rückführung deutscher Bestände starke Beachtung. Oxana Kosenko untersucht in ihrer 2018 erschienenen Dissertation »Sowjetische Archivpolitik in der SBZ... » meer |
|---|---|
|
Peter Gbiorczyk Zauberglaube und Hexenprozesse in der Grafschaft Hanau-Münzenberg im 16. und 17. Jahrhundert
Der ehemalige Pfarrer und Dekan des Kirchenkreises Hanau-Land, Peter Gbiorczyk, hat in den letzten Jahren einige Schriften zur regionalen Schul- und Kirchengeschichte verfasst, darunter waren Untersuchungen zur Entwicklung des Landschulwesens, über die zwei Reformationen in der Grafschaft Hanau-Münzenberg sowie über den Urgroßvater der Brüder Grimm, Friedrich Grimm. Die Quellenarbeit für diese Publikationen ließen auch die Bemühungen der gemeindlichen Organe zu Tage treten, die vorherrschenden Elemente des traditionellen Zauberglaubens herauszukristallisieren und zu bekämpfen, standen diese doch den reformatorischen Bestrebungen frühneuzeitlicher Staatenbildung diametral entgegen. Gbiorczyk nutzte also die genaue Aktenkunde und liefert mit dem vorliegenden Buch einen Beitrag zur lokalhistorischen Hexenforschung in Hessen. Die Studie ist klar und logisch aufgebaut: Auf die Einleitung (inklusive Forschungsübersicht, Quellenlage, methodisches Vorgehen und thematische Einführung) folgen sieben Kapitel, die jeweils dem Verdacht auf Zauberei und Hexenprozesse in den untersuchten Dörfern und Städten der Grafschaft Hanau-Münzenberg nachgehen. Der umfangreiche Anhang weist neben Worterklärungen jeweils ein Namens-, Orts- und Sachregister auf, sodass sich mit dem Buch gezielt nachschlagen und arbeiten lässt. Da noch keine lokalhistorische Gesamtdarstellung für die Hexenprozesse in der Grafschaft Hanau-Münzenberg vorlag, ist diese Lücke nun geschlossen. Mit äußerster Genauigkeit geht Gbiorczyk den Denunziationen auf Zauberei, Segensprechen, Fluchen, Schwören, Gotteslästerung, Wahrsagerei und Wetterläuten nach und zitiert häufig aus den zahlreichen Originalquellen. Zu diesen zählen die Protokolle der Kirchen- und Schulvisitationen, Kirchen- und Stadtordnungen, Protokolle obrigkeitlicher und kirchlicher Gremien sowie Supplikationen. Dass nicht alle Verdächtigungen zu einem Verfahren führen, zeigt der Fall der Elsa Nickel aus Kesselstadt. Diese wurde zwar eines Schadenszaubers verdächtigt, der Pfarrer der Gemeinde jedoch, Conrad Cless, setzte sich für die Angeklagte ein und entschuldigte sie (S. 51). Überhaupt wurden die meisten Verdächtigungen (nicht nur in der Untergrafschaft Hanau, sondern in fast allen untersuchten presbyterianischen Gemeinden) geschlichtet, es blieb bei Ermahnungen zu sittlichem und religiösem Leben und nur ganz vereinzelt wurden Geldstrafen erlassen. Die weltliche Obrigkeit musste so gut wie nie eingeschaltet werden. Anders als in den Presbyterien hingegen stellte sich die Situation in den Kondominaten mit dem Kurfürstentum Mainz (Freigericht Alzenau und Biebergrund) dar: Hier wurde in der Zeit von 1601 bis 1605 über 130 Personen wegen Verdacht auf Hexerei der Prozess gemacht und hingerichtet (126 Frauen und 13 Männer, S. 293). Markant sind die längeren Passagen aus den Urgichten und Prozessen der Angeklagten, die oft unter Folter, aber auch „in Güte“ (S. 228) stereotyp nach dem Teufel, nach dessen Namen sowie im weiteren Verlauf nach dem Abfall von Gott befragt wurden. In einem Fall in Assenheim (heute ein Stadtteil von Niddatal) kann Gbiorczyk anhand eines Rechnungsheftes sogar die Kosten der Gerichtsprozesse inklusive „Verzehrkosten“ der Angeklagten und Scharfrichter und somit die tatsächliche Hinrichtung „vom leben zum todt“ nachweisen (S. 234). Peter Gbiorczyks Studie ist ein wertvoller Beitrag zur Regionalgeschichte des 16. und 17. Jhs. Sie reiht sich in die steigende Anzahl der Publikationen zur Aufarbeitung der Hexenprozesse in Hessen ein (z. B. R. Füssel, Gefoltert, gestanden, zu Marburg verbrannt, Marburg 2020), und doch gelingt dem Autor durch die Quellenerschließung eine enge Fokussierung auf die Betroffenen, die nicht alle Studien zu diesem Thema so akribisch durchhalten. Dadurch erhält die Arbeit nahezu kulturanthropologische Qualitäten, hebt sie doch Personen hervor, die sonst nicht „zur Ehre der Aktenwürdigkeit erhoben“ worden wären (K. Köstlin, Historische Methode und regionale Kultur, Berlin 1987, S. 8). Dass die angeklagten Personen als Beispiele für Denunziation, Leid und – als Folge der juristischen Verurteilung – mit Tod konfrontiert waren, zeigt, wie stark die kollektive Angst im Umgang mit den Phänomenen Hexen und Hexenglaube in den Köpfen der Menschen manifestiert war, in Ausnahmefällen zu einer Art Massenhysterie geführt hatte und für einen langen Zeitraum in Europa dominant war. Dabei vergisst es der Autor nicht, die Überlagerung von krisenhaften Phasen (politischer, klimatischer und wirtschaftlicher Art) hervorzuheben, die insbesondere in der frühen Neuzeit immer wieder zu existenzieller Not in der Gemeinde und in der Bevölkerung führten und die Suche nach ‚Urhebern‘ und ‚Schuldigen‘ der Missstände begünstigte. Auch Gbiorczyks formulierter Anspruch, die für die Hexenprozesse verantwortlichen sozialen Akteure in den Gemeinden näher zu beleuchten und auf strukturelle Verflechtungen von Amtsinhabern hinzuweisen, gelingt dem Autor beispielsweise an der Hervorhebung der Doppelrolle der Schultheißen, die sowohl als leitende Dorfbeamten als auch als Vorsitz im Dorfgericht fungierten und wichtige Entscheidungen über den sozialen Frieden im Dorf sowie über das religiös-sittliche Leben der Einwohnerschaft treffen konnten. Quelle: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Band 72/2022, S.323-324 |
Recensie: 17.05.2023Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Band 72/2022, S.323-324 Reeks: Geschichtswissenschaft Peter Gbiorczyk - Zauberglaube und Hexenprozesse in der Grafschaft Hanau-Münzenberg im 16. und 17. Jahrhundert978-3-8440-7902-9 Der ehemalige Pfarrer und Dekan des Kirchenkreises Hanau-Land, Peter Gbiorczyk, hat in den letzten Jahren einige Schriften zur regionalen Schul- und Kirchengeschichte verfasst, darunter waren Untersuchungen zur Entwicklung des Landschulwesens, über die zwei Reformationen... » meer |
|